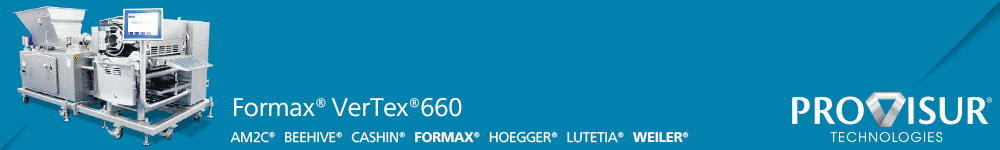EU-Lieferkettengesetz soll entschärft und verschoben werden

EU-Lieferkettengesetz soll entschärft und verschoben werden
Nach jahrelangen Verhandlungen war das europäische Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (CSDDD) 2024 als großer Schritt für mehr Menschenrechtsverantwortung in globalen Lieferketten verabschiedet worden. Doch nur ein Jahr später will das Europäische Parlament zentrale Punkte des Gesetzes im Eilverfahren überarbeiten – und das deutlich. Am Dienstag stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, bereits am Donnerstag, dem 3. April, über eine Verschiebung und Lockerung der Vorschriften abzustimmen.
Die neuen Fristen sehen vor, dass EU-Staaten das Gesetz erst bis Juli 2027 in nationales Recht umsetzen müssen. Große Unternehmen wären erst ab Juli 2028 verpflichtet, ihre Lieferketten auf Menschenrechtsverstöße zu überprüfen. Weitere Unternehmen würden schrittweise folgen.
Bürokratieabbau für KMU im Mittelpunkt
Ein zentrales Argument für die Reform ist der geplante Abbau bürokratischer Hürden – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Viele Betriebe hatten sich in der Vergangenheit über komplexe Berichtspflichten, unklare Anforderungen und unverhältnismäßige Haftungsrisiken beklagt. Nun soll das Gesetz so angepasst werden, dass es zwar die Grundidee der unternehmerischen Sorgfaltspflicht aufrechterhält, gleichzeitig aber den Verwaltungsaufwand für Betriebe reduziert.
Konkret geplant ist eine Entschärfung bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der sogenannten CSRD-Richtlinie. So sollen künftig nur noch Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden, einem Jahresumsatz über 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme über 25 Millionen Euro verpflichtet sein, detaillierte Berichte über Umwelt- und Sozialstandards vorzulegen. Dies würde zahlreiche kleinere Betriebe von der Berichtspflicht entlasten.
CDU-Abgeordneter Daniel Caspary begrüßt die Initiative ausdrücklich: „Wir werden die Berichtspflichten für kleine, mittlere und große Unternehmen massiv zurückbauen.“ Das sei ein notwendiger Schritt, um Europa wirtschaftlich widerstandsfähiger zu machen.
Sorge vor einer Aushöhlung des Gesetzes
Doch es gibt auch Kritik. Der Vorsitzende der SPD-Delegation im Europäischen Parlament, René Repasi, warnt davor, dass das Schnellverfahren missbraucht werde, um tiefgehende fachliche Diskussionen zu umgehen. „Ich befürchte, dass mit dem Argument des Bürokratieabbaus in Wahrheit der Haftungsrahmen für Unternehmen abgeschwächt wird“, so Repasi. Das führe nicht zu einer Entlastung, sondern zur Entwertung des ursprünglichen Ziels – nämlich den wirksamen Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards in globalen Lieferketten.
Besonders brisant: Das geplante Eilverfahren würde es erlauben, die Änderungen ohne weitere Beratung im zuständigen Ausschuss direkt zu verabschieden. Auch zahlreiche NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen zeigen sich alarmiert über diesen politischen Kurswechsel.
Schwieriger wirtschaftlicher Kontext als Begründung
In den Änderungsvorschlägen wird auf den „neuen und schwierigen Kontext“ verwiesen, in dem die Richtlinien umgesetzt werden müssten. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, gestiegene Energiepreise und zunehmende geopolitische Spannungen hätten die wirtschaftliche Belastung für Unternehmen in der EU massiv erhöht. Viele Unternehmen, so der Tenor, könnten die ursprünglichen Auflagen derzeit kaum stemmen.
Ob diese Argumente ausreichen, um die Zustimmung aller EU-Institutionen zu sichern, bleibt abzuwarten. Nach der Abstimmung im Parlament müsste auch der Rat der Europäischen Union grünes Licht für die Verschiebung und Anpassung geben.
Menschenrechtsschutz und Wettbewerbsfähigkeit – ein politischer Spagat
Das Lieferkettengesetz steht exemplarisch für den Spagat zwischen ethischen Standards und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Während Menschenrechtsorganisationen auf verbindliche Regelungen drängen, um globale Ausbeutung zu bekämpfen, sehen sich viele Unternehmen durch die Regulierung überfordert. Vor allem kleinere Betriebe ohne eigene Rechtsabteilungen oder internationale Erfahrung befürchten, unter die Räder zu geraten.
Für diese Unternehmen wäre ein gezielter Bürokratieabbau durchaus ein wichtiger Schritt – sofern dabei die Grundidee der Verantwortung in Lieferketten nicht verloren geht.
Die Reform des EU-Lieferkettengesetzes zeigt: Der politische Wille zur Entlastung der Wirtschaft ist stark – möglicherweise stärker als jener zum Schutz der Menschenrechte. Ob ein fairer Ausgleich gelingt, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Sicher ist nur: Die Debatte über unternehmerische Verantwortung ist längst nicht abgeschlossen.

 Jobs
Jobs
 Marktführer
Marktführer

 Suche
Suche