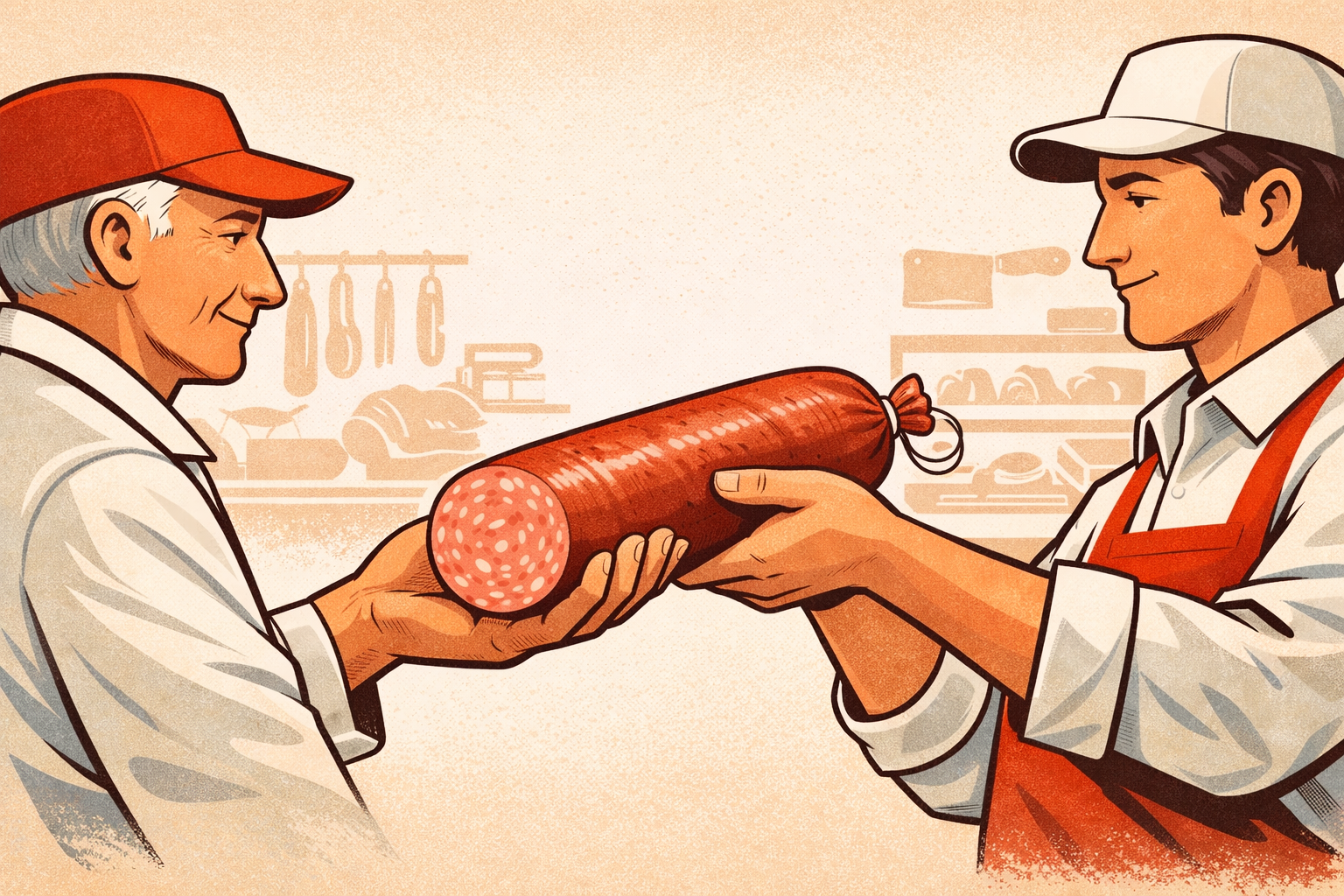Lebensmittelrecht und -sicherheit: Rückblick auf Lebensmittel.Recht.Up2Date 2023

Lebensmittelrecht und -sicherheit: Rückblick auf Lebensmittel.Recht.Up2Date 2023
Am 11. Oktober 2023 wurde im Wiener Ares Tower erneut die Tagung „Lebensmittel.Recht.Up2Date“ von Quality Austria und SAICON veranstaltet. Gut besucht von Vertretern des Lebensmittelsektors, Behörden, Begutachtung, Ministerien, Justiz und Rechtsanwaltskanzleien wurden die vergangenen und kommenden Entwicklungen im Lebensmittelrecht diskutiert und beleuchtet. Durch die Veranstaltung leitete der Sachverständige Andreas Schmölzer.
Rückblick auf Lebensmittel.Recht.Up2Date 2023: Aktuelle Entwicklungen im Lebensmittelrecht
Die Reihe an Vorträgen wurde von Rechtsanwalt Markus Grube mit einem Überblick zur Rechtsprechung eröffnet. Diese war kürzlich geprägt von Diskussionen rund um die Kennzeichnung von Lebensmitteln wie beispielsweise eine das Gewicht ergänzende Stückzahlangabe bei Süßwarenpackungen oder die Angabe von Austauschzutaten auf der Vorder- oder Rückseite.
Er hob auch eine für Deutschland wichtige Entscheidung zum Thema „Separatorenfleisch“ hervor, bei der eine frühere Einstufung bei Hühnerfleisch wieder rückgängig gemacht wurde – mit entsprechenden Folgen für die Produzenten. Beim Blick in die Zukunft sieht Grube die angekündigten großen (Kennzeichnungs-) Änderungen mit den Bausteinen Nährwertampel, Haltbarkeitsangaben, Herkunftskennzeichnung und Nährwertprofile noch von einer finalen Abstimmung weit entfernt – seiner Einschätzung nach ist mit einer Entscheidung dazu in dieser EU-Periode nicht mehr zu rechnen.
Schon seit einigen Monaten ist in Deutschland mittlerweile das Lieferkettensorgfaltsgesetz in Kraft, der Erfahrungsbericht von Markus Grube hierzu war überraschend. Da das Gesetz in erster Linie eine „Bemühenspflicht“ vorsieht, wird die kommende Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) vermutlich weit weniger drastisch als befürchtet.
Rechtsprechung und Lebensmittelüberwachung: Einblicke und Herausforderungen
Interessante Einblicke in die Herausforderungen der amtlichen Überwachung zeigte Ulrich Busch vom LGL Bayern. Ein spannender Schwerpunkt in der Überwachung waren Listerien bei pflanzlichen Lebensmitteln – bedingt durch Hygienedefizite in der Primärproduktion und beim Waschen und Schneiden – was zur Ausarbeitung eines entsprechenden Leitfadens für pflanzliche Rohkost führte. Weitere Schwerpunkte setzte das LGL Bayern bei sogenannten „Unverpacktläden“ und auf die Kontrolle von „NutriScore“-Ampeln – beides mit unauffälligen Ergebnissen. Zur Früherkennung von Lebensmittelbetrug werden mittlerweile komplexe Datenmodelle zur Beurteilung der Marktkonsistenz laufend ausgewertet.
Zeigt ein Markt Verwerfungen, intensiviert die Aufsicht die Probenziehung und Kontrolle. So können negative Entwicklungen früher eingedämmt werden. Besondere Beachtung verdient ein Forschungsprojekt zur Kühlkette. Um die Relevanz von Unterbrechungen bewerten zu können, arbeitet das LGL an einem Prognosemodell dessen Umsetzung aufgrund des beträchtlichen Aufwandes einige Jahre in Anspruch nehmen wird.
Lebensmittelrecht und Klimawandel: Auswirkungen auf die Produktwerbung
Mit Werner Schwarzmann konnte ein Richter des LVwG Niederösterreich gewonnen werden, der in seinem Beitrag die schwierige Frage des Sorgfaltsmaßstabes im lebensmittelrechtlichen Verwaltungsverfahren intensiv beleuchtete. Ausgehend von der speziellen österreichischen Verwaltungsrechtslage, bei der ein Verstoß bereits als Beweis des Sorgfaltsmangels definiert ist, hat der österreichische VwGH einen als unerreichbar angesehenen Anspruch an das unternehmerische Kontrollsystem entwickelt. Die dabei auftretende Lücke könnte durch Zertifizierungen zumindest teilweise geschlossen werden. Dazu erläuterte Andreas Schmölzer in Doppelconférence mit dem Vortragenden die Grundlagen des Zertifizierungssystems.
Der Begriff „Klima“ ist modern, was sich auch an der Produktwerbung und den damit einhergehenden Gerichtsentscheidungen zu unlauterem Wettbewerb mittlerweile deutlich niederschlägt. Daneben werden die geplanten Rechtsakte der EU zu Greenwashing und Umweltaussagen große Änderungen bewirken, wie Rechtsanwalt Martin Prohaska-Marchried zu erkennen gab. Zum einen wird es hier von Dritten bescheinigte Nachweise der tatsächlichen Klimaleistung brauchen, wobei die Bezeichnung „Waldschutz“ keinerlei Bedeutung mehr haben wird. Zum anderen wird die Schwarze Liste mit einer Reihe von künftig per se verbotenen Werbeaussagen ergänzt werden, was den Spielraum deutlich einschränken wird.
Allergene und Spurenkennzeichnung: Eine wichtige Überlegung im Lebensmittelsektor
Andreas Schmölzer von SAICON Consulting betonte in seinem Vortrag zum Thema Allergene, dass bei Produkten mit Spurenkennzeichnung eine Bevorzugung durch empfindliche Verbraucher zu erwarten ist. Daher muss eine derartige Spurenkennzeichnung auch alle Allergene jeweils über die gesamte Lebensmittelkette berücksichtigen, was der IFS V8 auch in entsprechenden Vorgaben formuliert hat. Dies gilt insbesondere für Produkte, die speziell für empfindliche Verbraucher empfohlen werden wie zum Beispiel Pseudocerealien für glutensensitive Personen.
Derartige Empfehlungen müssen erhoben und in einer Risikobetrachtung zur Entscheidung über Spurenkennzeichnung bewertet werden. Demgegenüber ergibt sich für Produkte ohne besondere Zielgruppe keine risikobegründete Entscheidung für Spurenkennzeichnung. Vielmehr ist zu befürchten, dass exzessive Spurenvermeidung in Produkten ohne Risikogruppe zu einem physiologischem Toleranzverlust bei der Allgemeinheit führt, wodurch die Verbreitung von Allergien sogar gefördert wird. In der Schweiz hat sich seit über 10 Jahren für Verschleppungen ein Grenzwert von 0,1% bewährt, in der EU bildet die Sichtbarkeit von Allergenresten die Sorgfaltsgrenze.

 Jobs
Jobs
 Marktführer
Marktführer

 Suche
Suche